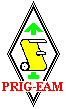Rückblick: (Wie alles begann....)
von Georg Giese, DF2AU
Als eine Gruppe von Funkamateuren im kanadischen Vancouver im Jahre 1978 mit
Experimenten zur digitalen Nachrichtenübermittlung begannen, ahnte noch niemand,
welche rasante Entwicklung dieser Technik noch bevor stand. Nach der Vancouver
Amateur Digital Communications Group (VADCG) bildete sich 1981 in Tucson/USA die
Tucson Amateur Packet Radio Vereinigung TAPR.
Diese Gruppe entwickelte später den schon fast legendären TAPR TNC-1 (Terminal
Node Controler) mit einer Amateurversion des kommerziellen X.25 Protokolls,
genannt AX.25, die sich weitgehend gegenüber der VADCG-Version durchgesetzt hat.
Das AX.25 Protokoll der Ebene 2 ist inzwischen auch weltweit von der IARU als
neuer Standard und neue Betriebsart anerkannt worden.
Seit Anfang 1984 ist der Datenpaketfunk (im Folgenden als Packet Radio
bezeichnet) auch in der Bundesrepublik vertreten. Waren am Anfang nur ganz
wenige Stationen in Hannover, Braunschweig und München vertreten, so stieg die
Zahl innerhalb weniger Wochen (zum Teil dank gut organisierter Masseneinkäufe
durch den Distrikt Bayern Süd) schon deutlich an. Bis heute ist die Zahl der
Packet Radio Stationen fast explosionsartig gestiegen, was u.a. an Nachfolgegeräten vom TNC-1 (damals als Bausatz über 800 DM!!) wie TNC-2,
entsprechenden Nachbauten, C64/Apple-Softwarelösungen, aber auch neuen
kommerziellen Produkten von KANTRONIC, AEA, usw. zu verdanken ist.
Diese Entwicklung führt auch dazu, dass ältere Betriebsarten wie RTTY mehr und
mehr verdrängt, bzw. durch diese neue Technik besonders auf UKW abgelöst werden.
Die Vorteile von Packet Radio liegen klar auf der Hand:
100%ig fehlerfreie Datenübertragung (Texte usw.) auch unter zeitweise gestörten
Bedingungen, z.B. mit Informationssystemen (Packet Radio Mailboxen).
Ökonomische Auslastung der Frequenzen, da zugleich eine große Anzahl von
Stationen den gleichen Kanal benutzen kann.
Im Vergleich zu anderen Betriebsarten, hohe Übertragungsgeschwindigkeiten
möglich.
Zweifelsohne gehört Packet Radio zu einer der modernsten Entwicklungen im
Amateurfunk. Die Folgen werden mit Sicherheit genauso revolutionär sein, wie
damals die Einführung von FM und SSB im Amateurfunk, die dann ja auch später im
kommerziellen Bereich die Betriebsart AM weitgehend abgelöst hat. Dabei befindet
sich die Entwicklung von Packet Radio gerade erst am Anfang.
Nachdem die HF-Technik fast ausgeschöpft zu sein scheint (abgesehen von einigen
hochmodernen, mit mehreren Mikroprozessoren gesteuerten Funkgeräten mit tauben
Empfängern), bietet die digitale Kommunikationstechnik für viele
computerbegeisterte Funkamateure, im Sinne des experimentellen Charakters des
Amateurfunks, ein neues Betätigungsfeld. Vorsicht ist jedoch geboten, denn
Funkgeräte und Modems sind wichtigster Bestandteil von Packet Radio. Parallel
mit der Weiterentwicklung von Packetvermittlungssystemen (Digipeater,
Netzknoten, usw.) müssen auch neue Wege in der Übertragungstechnik und bei den
Modulationsarten gesucht werden, denn der Bedarf nach sicheren und schnellen
Verbindungslinien wird immer größer. Ein Packet Radio Netz ist jedoch nur so gut
wie seine HF-Strecken.
Der Beginn in unserem Einzugsbereich
Ende 1984 / Anfang 1985 schlossen sich interessierte Funkamateure aus dem
größeren Einzugsbereich von Hannover, Braunschweig und Göttingen zur NORD><LINK
Arbeitsgruppe Datenpaketfunk zusammen. Ziel war es, geeignete Geräte (Hardware, Software) für Packet Radio zu
entwickeln. Im Vordergrund stand jedoch die Errichtung von Digipeatern (Digital
Repeater) um der Allgemeinheit auch die Überbrückung von größeren Entfernungen,
mit späterer Netzbildung, zu ermöglichen.
Denn schon in den ersten Tagen stellte sich heraus, dass ein sinnvoller Betrieb
nur geordnet verlaufen kann, wenn man Chaos und Enttäuschung vermeiden möchte.
Die Entwicklung des Netzes in unserem Raum lässt sich in mehrere Stufen aufteilen:
STUFE 0: Keine Digipeater.
Der gesamte Betrieb spielte sich auf der 2m-Frequenz 144.675 MHz (-25 kHz
Arbeitsbereich, leider kaum benutzt) ab. Es gab keine Digipeater an exponierten
Standorten, so dass jede Station selbst als Digipeater fungierte und Pakete
ihren Empfänger auf diese Weise nur unter viel Mühe erreichten. Größere
Entfernungen waren kaum möglich, weil wegen vieler Kollisionen (mehrere
Stationen senden gleichzeitig) bei längeren Strecken über mehrere solcher
privaten Digipeater, Pakete verloren gingen und dadurch häufig wiederholt werden
mussten. Folglich rissen Verbindungen sehr häufig ab oder benötigten trotz der
recht hohen Baudrate unangemessen viel Zeit. Kurzum, die Angelegenheit war nicht
sehr zufriedenstellend und das Chaos wuchs und wuchs.
STUFE 1: erste Digipeater auf 2m.
Nachdem die Stufe 0, trotz aller Begeisterung für die Technik, nicht
zufriedenstellend arbeitete, begann die Suche nach Ausbaumöglichkeiten. Zu
Versuchszwecken wurden schließlich in Hannover am Deister, in Braunschweig und
in Göttingen einfache Digipeater mit guten Antennen. auf hohen Standorten
errichtet. Über diese Digipeater war es nun möglich, Entfernungen von teilweise
über 100 km zu überbrücken. Ende November 1984 wurde auch in Hamburg ein
Digipeater auf 144.675 MHz von der späteren Hamburg Packet Radio Gruppe (kurz
HPRG) errichtet. Unter normalen HF-Bedingungen war es nun durchaus möglich, auch
Verbindungen von Göttingen bis Hamburg (maximal 2 bis 3 Digipeater) aufzubauen.
Aber auch im Nahbereich wurde durch die hochgelegenen Digipeater die Situation
zunächst deutlich besser und viele "wilde" private Digipeater wurden
überflüssig, was wiederum zur Entlastung der Frequenz führte. Doch zeigten sich
dank stetig steigender Aktivität schon wenige Monate später die Grenzen eines
solchen Netzwerks, es kam zu Blockierungen. Die Ursache dafür liegt in der
Betriebsart mit Vielfachzugriff, d.h. mehrere Stationen beanspruchen die gleiche
Frequenz zur gleichen Zeit. Um sogenannte Kollisionen (also Doppelaussendungen)
zu vermeiden, besitzen die TNCs eine DCD-Logik (Data Carrier Detect). Diese
Logik bewirkt, dass der eigene TNC nur dann auf Sendung geht, wenn die
Arbeitsfrequenz frei ist und keine andere Station gehört wird. Hören sich alle
Stationen untereinander, dann ist hierdurch ein fast problemloser Betrieb
gewährleistet. Bei einem Digipeater mit großer Reichweite ist die Sachlage
jedoch etwas einseitig: Der Digipeater wird von allen Benutzern gehört und der
Digipeater hört alle Benutzer. Aber viele Benutzer hören sich NICHT
untereinander!! Die Folge davon ist, dass häufig mehrere Stationen gleichzeitig
senden, da für jeden Einzelnen die Frequenz scheinbar frei ist. Daraus
resultiert eine Kollision der Pakete und der Digipeater hört entweder nur
Interferenzen, die er nicht dekodieren kann, wenn beide Stationen annähernd
gleich stark sind. Ist eine Station deutlich stärker, so hört er in diesem
Moment nur deren Signal, welches dann anschließend wieder abgestrahlt wird. Alle
anderen Stationen werden nach kurzer Zeit automatisch ihr Paket wiederholt
ausstrahlen und erleiden u.U. wieder das gleiche Schicksal. Hinzu kommt noch,
dass sich die Digipeater untereinander sehr stark hörten, aber nicht jeweils die
Benutzer des anderen Digis. Diese Effekte führten zur chronischen Taubheit der
Digipeater und so war es nicht selten, dar der Datendurchsatz auf nur 25%
(ALOHA, unkoordinierter Vielfachzugriff) absackte, wenn zu viele Stationen auf
die Digipeater drängten und mehrere Mailboxen an verschiedenen Stellen aktiv waren.
STUFE 2: erstes lokales Netzwerk mit 70cm-Interlink und 2m-Einstieg.
Eine Lösung der Probleme schien nur dadurch möglich, dass man die Reichweite der
Digipeater wieder verkleinerte (sie war ja nur deshalb sehr groß gewählt worden,
um auch andere Digis direkt erreichen zu können) und eine andere Möglichkeit
fand sie direkt untereinander zu vernetzen, ohne damit die Benutzerfrequenz
weiterhin zu belasten. Nach ersten Überlegungen zu einem eigenen
Netzknotenrechner (DON & DONNA), der dann wieder aufgegeben wurde, fand sich die
Lösung dann in einer von Michael, DC40X, aufbauend auf der WABDED-Software vom
TNC-1, entwickelten NORD><LINK INTERLINK-Software. Hierbei wurde je ein
Funkgerät mit TNC und Interlink-Softwe are auf 2m (Netzeinstieg) und 70cm
(Interlink) installiert und beide TNCs über die RS232-Schnittstelle gekoppelt.
Wollte jetzt ein Benutzer in Hannover eine Verbindung nach Göttingen aufbauen,
so musste er nur DB0FD und DB0FE als Digipeater angeben.
Die Software kümmerte sich automatisch um das Weiterleiten, indem sie anhand
einer Liste die Rufzeichen analysierte. Waren der erste und der zweite
Digipeater als Interlink-Digi bekannt -in diesem Fall DB0FD und DB0FE- so wurde
das Paket nicht auf 2m, sondern auf 70cm weitergeleitet. In Göttingen wurde es
vom anderen Interlink- Digi erkannt und weil kein weiterer Interlink-Digi
angefügt war, wieder auf 2m ausgestrahlt. Dieses Konzept welches seit Anfang
1986 für fast 1 1/2Jahre lief, erwies sich als voller Erfolg. Zusammen mit DB0FC
(Braunschweig) und DLORI (auf dem Knüll) entstand das erste funktionsfähige
Netzwerk auf Level 2 Ebene in der Bundesrepublik. Das Netz erfreute sich großer
Akzeptanz und über weitere 2m-Digipeater waren Verbindung von Bremen (bis hinter
Knüll) nach Frankfurt möglich.
STUFE 3: 2m-Netzeinstieg und 70cm-Interlink auf Level 3/4 Ebene des ISO-
Schichtenmodells.
Eine wesentliche Verbesserung des Datendurchsatzes auf Protokoll-Ebene lässt
sich nur durch höhere Netzwerkprotokolle erreichen. Nach dem 7-stufigen ISO-
Schichtenmodell sind hierfür der Level 3 (NETWORK-LAYER) und der Level 4
(TRANSPORT-LAYER) vorgesehen. Level 2 ist der eigentliche LINK-LAYER, der
prinzipiell nur für Verbindungen zwischen jeweils 2 direkt benachbarten
Endstellen (Benutzer, Knoten, usw.) gedacht ist und in den normalen TNCs zur
Anwendung kommt. Hinzu kommt, dass ein rein auf Level 2 aufgebautes Netz nur
einen begrenzten Umfang erreichen kann. So sind laut Protokoll-Spezifikation
nicht mehr als 8 Digipeater zwischen zwei Stationen zulässig. In der Praxis ist
es aber kaum möglich, Strecken mit mehr als 3 Digipeatern aufzubauen. Der Grund
dafür liegt in den schon mehrfach beschriebenen Kollisionen. Geht auf der langen
Strecke nur ein einziges Paket verloren, so muss der komplette Vorgang
wiederholt werden. Dieses macht deutlich, dass eine Vernetzung von größeren
Regionen hur mit höheren Protokollen sinnvoll durchführbar ist. Seit Sommer 1987
ist unter der Bezeichnung NET/ROM eine Software verfügbar, die diesem Ziel schon
sehr nah kommt. Die Vorteile gegenüber dem vorherigen NORD><LINK Interlink-Konzept
auf Level 2 Ebene waren so ausschlaggebend, dass sich die NORD><LINK
Gruppe und damit besonders die Betreiber der Netzknoten, im Sommer entschlossen
hatten, die alten TNC-1 gegen neue TNC-2 mit NET/ROM auszutauschen.
Entscheidender Vorteil gegenüber der alten Methode des Digipeatings ist der
Bestätigungsverkehr zwischen den einzelnen NET/ROM-Knoten, was einen größeren
und schnelleren Datendurchsatz zur Folge hat. Der Benutzer muss lediglich seinen
eigenen Netzknoten connecten (z.B. H:DB0FD) und kann als nächstes seinen
Zielknoten anwählen (z.B. GOE für DB0FE in Göttingen). Wichtig ist, dass der
Benutzer den eigentlichen Weg zum Ziel nicht kennen muss, dieses übernimmt die
Software vollautomatisch und stellt eine Verbindung auf dem besten Weg her. Am
Ziel angekommen, kann der Benutzer nun seinen Partner connecten. Treten zwischen
dem Partner in Göttingen und dem dortigen Knoten Wiederholungen auf, so bleiben
sämtliche anderen Strecken von zusätzlichen Kollisionen verschont und somit der
Betrieb flüssiger. Seit Einführung von NET/ROM ist eine deutliche Steigerung des
Datendurchsatzes eingetreten. Jeder einfache Digipeater wäre bei den derzeitigen
Benutzern und Datenmengen überfordert.
Seit einiger Zeit ist nun NET/ROM durch THENET die neue Software von Michael,
DC40X und Georg DF2AU im Einsatz.
Durch eine konsequente Entwicklung der Netzstruktur, angefangen mit dem
Netzeinstieg auf 2m und Interlink auf 70cm und die Verwendung höherer
Netzebenen, wurde eine Kanalisierung des 2m Packet Radio Betriebs erreicht und
den Benutzern ein funktionsfähiges Netz zur Verfügung gestellt, dass für
Jedermann erreichbar ist.
Heute sind von den erwähnten 2m-Einstiegen in DL noch DB0FC, DB0FD und DB0FE
vorhanden. Netzeinstiege findet man heute in der Regel im 70 cm Band, ebenso
wird die Vernetzung der Digipeater untereinander im 23 cm Band durchgeführt.
© 2008 Prig-EAM e.V. DB8AS & DF2AU |